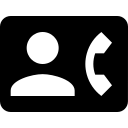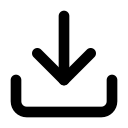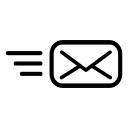Das Potenzial von Biogas erschließen: Ein detaillierter Blick
Biogasanlagen: Arten und Einteilungen
Biogasanlagen bilden eine wichtige Schnittstelle zwischen nachhaltiger Energieerzeugung und Abfallwirtschaft. Durch die Nutzung organischer Materialien bieten diese Anlagen einen doppelten Vorteil: Sie reduzieren die Umweltverschmutzung und erzeugen gleichzeitig erneuerbare Energie aus Rückständen und vermeintlichen Abfällen. Um sich in der Landschaft der erneuerbaren Energien zurechtzufinden, ist es wichtig, die verschiedenen Arten und Unterkategorien von Biogasanlagen zu verstehen.
Nassfermentation und Trockenfermentation
Die zwei Methoden der Vergärung
Biogasanlagen werden gerne nach unterschiedlichen Gesichtspunkten unterteilt. So wird zum Beispiel zwischen Nassfermentation und Trockenfermentation unterschieden. Bei der Nassfermentation werden die Feststoffe mit einer Flüssigkeit vermischt. Die so entstandene Biosuspension ist in der Regel fließfähig und wird mit Pumpen gefördert. Bei der Trockenfermentation wird stapelbare Biomasse in einem sogenannten Boxen-Fermenter bzw. Garagen-Fermenter aufgepackt und anschließend mit einer Flüssigkeit, dem sogenannten Perkolat, berieselt. Unten austretendes Perkolat wird auffangen und wieder von oben auf die Biomasse gegeben. So wird der Vergärungsprozess und damit die Biogas-Produktion ermöglicht. Dieser Anlagentyp ist nicht so weit verbreitet und kommt vornehmlich beim Vergären von Bioabfällen wie Grünschnitt oder den sogenannten brauen bzw. grünen Mülltonnen (Bioabfall aus Haushalten) zum Einsatz.
Biogasanlagen und Biomethananlagen
Wichtig ist was rauskommt
Eine weitere Variante ist die Unterteilung in Biogasanlagen- und Biomethananlagen. In beiden Anlagentypen wird Biogas produziert. In Biogasanlagen, dem in Deutschland am meisten verbreiteten Typ, wird dieses Biogas etwas aufbereitet und direkt vor Ort in einem Blockheizkraftwerk (BHKW) in elektrische und Wärmeenergie umgewandelt. Biomethananlagen bereiten das Biogas so weit auf, dass es – wie Erdgas – fast nur aus Methan besteht. Dieses Biomethan kann daher direkt in das Erdgasnetz gespeist werden, um anschließend dort entnommen und verbrannt zu werden, wo die Energie benötigt wird.
Abfallpflanzen
Sinnvolle Verwendung von organischen Abfällen
Eine weitere verbreitete Einteilung erfolgt aufgrund der eingesetzten Biomasse. Sie unterscheidet zwischen Kofermentations- bzw. Abfall-Anlagen und NaWaRo-Anlagen. Der Begriff der Kofermentations-Anlage geht zurück in die Anfangszeit des Biogas-Booms in Deutschland. Landwirte bauten Anlagen, mit denen Sie die Energie, welche noch in der Gülle enthalten ist, in Form von Biogas nutzbar machen wollten. Schnell merkten sie, dass sich deutlich mehr Biogas erzeugen lässt, wenn man der Biogasanlage neben der Gülle sogenannte Ko-Fermente wie Futterreste, Getreide oder auch Biomüll bzw. Bioabfälle zuführt. So entstand der Begriff Kofermentations-Anlage für Biogasanlagen, die neben landwirtschaftlichen Reststoffen wie Gülle und Mist auch industrielle Rest- und Abfallstoffe fermentieren. In der weiteren Entwicklung ging der Anteil dieser landwirtschaftlich basierten Biogasanlagen, die Abfallstoffe vergären, stark zurück. Dafür wurden viele industrielle Anlagen zur Verwertung von kommunalen, gewerblichen und industriellen Reststoffen und Abfällen gebaut. In Zuge dieser Entwicklung setzte sich für Biogasanlagen in denen Bioabfall vergoren wird, der Begriff Abfall-Anlage durch.
NaWaRo-Anlagen
Was das ist und worin sich diese unterschieden
Der Begriff NaWaRo-Anlagen entstand, als die Vergärung von nachwachsenden Rohstoffen, wie z.B. Energiepflanzen, finanziell besonders gefördert wurde: Neben landwirtschaftlichen Reststoffen dürfen diese Biogasanlagen nur nachwachsende Rohstoffe vergären. Landwirtschaftliche Reststoffe sind i.d.R. Mist und Gülle. Typische NaWaRo (Energiepflanzen) sind
- Mais- und Grassilage,
- GPS (Ganzpflanzensilage) aber auch
- Feldfrüchte wie Kartoffeln und Rüben usw., sofern Sie nicht für die Lebensmittelproduktion geeignet sind bzw. vorgesehen waren.
Gerade in Deutschland ist dieser Anlagentyp weit verbreitet, für den hier spezielle Vorschriften aber auch Förderungen nach dem Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) gelten. Sie stellen für viele landwirtschaftliche Betriebe ein weiteres Standbein dar, welches einen relativ gut kalkulierbaren und wenig schwankenden Ertrag liefert.